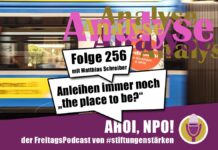Der Stifterwille, das ungeschmälerte Erhalten des Stiftungskapitals, die Erträge. In diesem Spannungsfeld bewegen sich Stiftungen in der Kapitalanlage, auch nach oder mit Corona. Der Corona-Schock jedoch hat es sicherlich in vielen Stiftungen notwendig gemacht, eine ordentliche Bestandaufnahme zu machen und Spielräume auszuloten, die es post-Corona zu nutzen gilt, denn in so manchem Stiftungsvermögen fehlt doch eine Portion Zukunftsfestigkeit. Insofern ist die aktuelle Krise eine Chance, auch und gerade für Stiftungen.
Zunächst einmal gilt es, unaufgeregt auf die Gesamtsituation zu reagieren. Zwar existiert für Stiftungsverantwortliche die Aufgabe, durch die Anlage des Stiftungsvermögens ausreichende Erträge für die Zweckerfüllung zu erwirtschaften und gleichzeitig das stiftungsrechtliche Gebot der Vermögenserhaltung zu beachten – diesen Vorgaben können Stiftungen jedoch mit einer gewissen Gelassenheit begegnen. Weder macht das Gesetz verbindliche Vorgaben für das Vermögensanlagekonzept noch nennt es einen Zeitraum, in dem der Bestand des Vermögens zwingend zu erhalten ist. Insbesondere da Stiftungen auf die Ewigkeit hin errichtet wurden, sind zwischenzeitliche Schwankungen der Vermögenswerte hinnehmbar, vor allem in dem Wissen, dass in den vergangenen 150 Jahren jeder Börseneinbruch letztlich in der langfristigen Betrachtung nur vorübergehend war. Da Stiftungen Langfristanleger qua DNA sind, fehlt ein exakter zeitlicher Rahmen, etwa die Jährlichkeit, der es verhindern würde, zwischenzeitlichen Wertverzehr hinzunehmen.
DER STIFTERWILLE WEIST DEN WEG
Ein zweiter historischer „Wegweiser“ ist der Stifterwille. Dieser bildet für Stiftungen die oberste Handlungsmaxime. In welchem Umfang welche Anlageinstrumente in das Stiftungsportfolio eingebaut werden dürfen, ist dem Stiftungsgeschäft und der Satzung entweder direkt zu entnehmen oder aber aus ihnen abzuleiten. Fehlt es an klaren Vorgaben, lassen sich meist aus dem Stiftungszweck Anforderungen an die Anlagepolitik und den Erhalt des Stiftungskapitals entnehmen. Für die Frage, was in der Vermögensanlage zulässig ist und was nicht, gibt auch die Höhe des Stiftungsvermögens einen Anhaltspunkt. Kleinere Stiftungsvermögen weisen auf einen etwas schmaleren Fokus; sie können nach ihren tatsächlichen Möglichkeiten nicht sämtliche möglichen Bausteine einer zeitgemäßen Anlagepolitik nutzen. Manches Anlageprodukt „geht“ also einfach nicht bei diesen Stiftungen. Eher größere Stiftungen können sich breiter aus dem Baukasten bedienen, da hier schlicht aufgrund der Größe des Stiftungsvermögens breiter diversifiziert werden kann. Wichtig ist: Egal wie groß das Stiftungsvermögen ist, es muss so angelegt werden, dass das Risiko gestreut wird; die Anlage des Stiftungsvermögen soll möglichst dem Diversifikationsgebot folgen.
HAFTUNGSFREIER ERMESSENSPIELRAUM
Womit schon die Ebene der konkreten Anlageentscheidung erreicht wäre. Grundsätzlich verfügen die zuständigen Stiftungsorgane prinzipiell über einen recht weiten und dabei auch haftungsfreien Ermessensspielraum. Dieser ist auszufüllen – mit Entscheidungen zum Wohle der Stiftung auf Basis angemessener Informationen und mit der notwendigen Sorgfalt des gewissenhaften Geschäftsleiters. Übersetzt auf die Anlage des Stiftungsvermögens bedeutet dies nichts anderes als, dass das Verhältnis zwischen Rendite, Sicherheit und Liquidität austariert und dabei die individuelle Situation der Stiftung berücksichtigt werden muss. Insbesondere muss die erarbeitete Anlagepolitik der langfristigen und weitreichenden Verwirklichung des Stiftungszwecks dienen. In der täglichen Praxis vieler Stiftungen verhält es sich jedoch so, dass die Sorgen vor möglichen Sanktionen seitens der Stiftungsaufsicht und der persönlichen Haftung zu einer unnötigen Risikoaversion führen. In Kombination mit psychologischen Tücken und sich hartnäckig haltenden Irrtümern führt dies letztlich immer wieder zu Fehlentscheidungen auf der operativen Ebene.
MÜNDELSICHER ANLEGEN – DAS WAR GESTERN
Entgegen immer noch verbreiteter Irtümer ist es genau nicht so, dass Stiftungen nur mündelsicher anlegen oder nur eine Aktienquote von maximal 30% in ihrem Portfolio aufbauen dürfen. Diese Vorgaben gibt es – außerhalb entsprechender Satzungsvorgaben – schlichtweg nicht. Auch sind Alternative Investments wie Hedgefonds oder Private Equity nicht von vorn herein als Stiftungsanlage ausgeschlossen, sie sind nur angesichts ihrer Leistungs- und Gestaltungsmerkmale häufig als Stiftungsinvestment ungeeignet. Da es aber heute den risikolosen Zins nicht mehr gibt und damit ausreichende ordentliche Erträge durch eine Investition allein in festverzinsliche Anlagen kaum mehr erwirtschaftet werden können, bedarf es eines grundsätzlichen Umdenkens. Beispielsweise sind Aktien durchaus ein stiftungsgeeignetes Investment, insbesondere angesichts ihres Charakters als Sachwert und vor allem wegen regelmäßiger Ertragszahlungen in Form von Dividenden. Der jüngste Corona-Crash konnte dabei helfen, Aktien von solide wirtschaftenden und verantwortungsbewusst agierenden Unternehmen auf einem niedrigen Einstandsniveau zu erwerben, denn genau solche Marktverwerfungen sind für Langfristanleger wie Stiftungen gute Gelegenheiten, die leider viel zu selten genutzt werden.
DIVERSIFIKATION MACHT STIFTUNGSVERMÖGEN RESILIENTER
Stiftungen, die hier nicht so versiert sind, können sich auch Vehikeln wie etwa ausschüttungsstarken Aktienfonds bedienen. Diese Möglichkeit kann für Stiftungen ein stimmiger Weg sein, Selektion und Bewertung einzelner Aktien in die Hände von Profis zu delegieren. Reine Aktienfonds können durchaus zur Gruppe der stiftungsgeeigneten Fonds gezählt werden, wenn sie bestimmte Ausstattungsmerkmale mitbringen. Ein Fonds gewährleistet zudem die Diversifikation, die bei allen Anlageentscheidungen stets vorgenommen werden sollte. Und natürlich werden über die Fondsanlage auch die Stiftungsverantwortlichen in gewisser Weise entlastet – wenngleich die Kontrolle der Fondsanlagen bei den Stiftungsverantwortlichen bleibt. Diversifizieren heißt, das Vermögen auf der Anleiheseite über verschiedene Schuldner, auf der Aktienseite über verschiedene Unternehmen, auf der Instrumentenseite über verschiedene Stile und Strategien und auf der Anbieterseite über verschiedene Anbieter von Produkten zu streuen. Nur ein ausbalanciertes Stiftungsportfolio kann im aktuellen und absehbaren Kontext langfristig die Ertragschancen erhöhen, die Geldflüsse optimieren und Ausfall- und Verlustrisiken minimieren. Hieraus leitet sich dann schließlich eine höhere Resilienz des Stiftungsvermögens in Krisenzeiten ab.
HINWEIS: Dr. Christoph Mecking wird beim Virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen am 24.6.2020 die Keynote zum Thema halten, welche Parameter für Stiftungen in der Verwaltung ihres Vermögens wesentlich sind. Weitere Infos finden Sie unter www.vtfds2020.de

WERTSCHWANKUNGEN SCHADEN NICHT
Auch ein breit diversifiziertes Portfolio hat keine eingebaute Garantie gegen Wertschwankungen. Wertschwankungen – in volatilen Märkten oder aufgrund von Krisen – sind normal und gehören zur Kapitalanlage dazu. Stiftungen können dies aber aufgrund ihres Langfristbias in der Kapitalanlage sehr gut „aushalten“, der Vermögenserhalt – ob nominal oder real – unterliegt keiner Jährlichkeitsbetrachtung. So sind insbesondere vorübergehende Wertverluste hinzunehmen, vor allem wenn die langfristige Planung erkennen lässt, dass das Kapital innerhalb des festgelegten Konzepts mittelfristig erhalten bleiben dürfte und zudem weiterhin ausreichend Erträge generiert werden. Selbst wenn sich aus einer zulässigen (risikoreichen) Anlage ein Verlust realisiert, handelt es sich nicht um eine steuerlich schädliche Mittelverwendung und auch um keinen unzulässigen Einsatz gemeinnützigkeitsrechtlich gebundener Vermögensgegenstände. Auch ein Totalverlust gefährdet den Status der Steuerbegünstigung nicht. Denn selbst bei sorgfältigster Auswahl von Anlageoptionen lassen sich negative Entwicklungen – wie wir sie gerade erleben – nie komplett ausschließen. Wichtig ist, dass jede Anlageentscheidung ausreichend dokumentiert wird, um nachvollziehen zu können, dass die Entscheidung aufgrund ausreichender rationaler Informationen zum Wohle der Stiftung getroffen wurde.
ANLAGERICHTLINIE BRAUCHT ES, UNBEDINGT!
Was in der Kapitalanlage immer hilft, sind Anlagerichtlinien. Diese regeln die essenziellen Grundsätze der Vermögensbewirtschaftung und sind ein unerlässliches Instrument für jede Kapitalstiftung. Anlagerichtlinien dienen dazu, die meist recht allgemein gehaltenen bzw. gänzlich offenen Aussagen der Satzung zur Vermögensverwaltung der Stiftung zu konkretisieren. Indem sie die Ziele der Stiftung als Investorin sowie die Pflichten und Handlungsspielräume der internen Entscheidungsträger und der externen Bankberater und Vermögensdienstleister festlegen und das Risikomanagement innerhalb der Vermögensverwaltung beschreiben, schaffen Anlagerichtlinien eine verbindliche Grundlage für zielorientierte, strukturierte und nachvollziehbare Anlageentscheidungen. Damit dienen sie letztlich auch dazu, Haftungsrisiken zu minimieren.
ZUSAMMENGEFASST
Die Stiftungslandschaft ist so bunt, dass es kein Patentrezept für das richtige Anlegen des Stiftungsvermögens geben kann. Aber es gibt ausreichende Hinweise und Bausteine, die die Vermögensverwaltung nicht zur unüberwindlichen Hürde machen. Sein Anlageziel zu kennen, eine Anlagerichtlinie zu beschließen, eine Idee davon zu haben, was die Stiftung von ihrer Anlagepolitik erwartet und eine Erwartung dahingehend, was Anlageinstrumente leisten müssen, das ist von allen Stiftungen zu schaffen. Niemand verlangt von Stiftungen, dass sie alle Anlageexperten werden, und die Lösung, die Aufgabe der konkreten Vermögensverwaltung der Stiftung an Anlageexperten zu delegieren, ist naheliegend. Es kommt darauf an, ein paar grundsätzliche Überlegungen anzustellen, um die Spielräume überhaupt und besser nutzen zu können. Insofern kann die Corona-Krise ein Weckruf für Stiftungen sein. Nein, ich bin sicher, sie wird ein Weckruf sein.