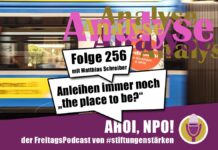Antworten für das Stiftungsvermögen zu finden, das ist derzeit nicht so leicht. Irgendwie ist die Anlagewelt im Zäsur-Modus. Geopolitisch ist der Ukraine-Krieg eine Zäsur, geldpolitisch das enorm rasche Anziehen der Leitzinsen seitens der FED und der EZB. Stiftungsspezifisch kann die Stiftungsrechtreform, die am 1.7.2023 in Kraft tritt, auch eine Art Zäsur sein. Wir waren nun jüngst beim Lupus alpha Investment Fokus 2023 zu Gast, wieder wollten wir wie gehabt drei Lehren aus Stiftungssicht mitbringen. Eigentlich haben wir aber Fragen mitgebracht, die Stiftungen sich für ihr Stiftungsvermögen jetzt stellen sollten.
Aber der Reihe nach. Es wurden auf dem Lupus alpha Investment Fokus 2023 einige sehr schlaue Sätze gesagt. Beispielsweise, dass das was wir derzeit in der Sicherheitspolitik sehen, so etwas wie der Ground Zero der internationalen Sicherheitspolitik sein dürfte. Ebenfalls wurde Robert Wallace zitiert, der Manager des Stiftungsvermögens der Stanford University. Dieser sagte, auf dem Lupus alpha Investment Fokus 2022, dass der Erfolg einer Asset Allocation ist untrennbar damit verbunden, diese auch umsetzen zu können. Nicht zuletzt fand auch Winston Churchill Eingang ins Programm. Sein „Lass eine Krise niemals ungenutzt verstreichen“ ist ein zeitloses Bonmot, das im Täglichen (auch der täglichen Stiftungspraxis) durchaus zum Roten Faden taugt. Was uns zu Frage Nummer 1 für das Stiftungsvermögen führt.
Frage 1: Sollen Stiftungen deutsche Aktien kaufen?
Ausgehend von der Annahme, dass Deutschland ein Geschäftsmodell 3.0 findet und ein erklecklicher Teil der anstehenden industriellen schöpferischen Zerstörung (von Robert Wallace ebenfalls 2022 formuliert) in Europa stattfinden wird (wovon Deutschland profitieren wird), sind deutsche Aktien durchaus eine Idee für das Stiftungsvermögen. Sofern Stiftungen ihre Aktienquoten auszubauen gedenken, muss die Frage nach deutschen Aktien automatisch auf dem Tisch liegen. Denn so pessimistisch wie die Stimmung derzeit ist, ist sie nicht bei allen Unternehmen bzw. deren Lenkerinnen und Lenkern. Für viele ist Scheitern keine Option, sie werden kämpfen um ihren Platz in einer kreativ-industriellen Welt, und sie haben mit diesem Kampf bereits begonnen.
Für Stiftungen stellt sich die Frage nach deutschen Aktien auch aus einem anderen Grund. Ihr Dasein fußt in vielen Fällen auf unternehmerischen Erfolgen, die möglich waren, weil Deutschland den passenden Rahmen dafür schaffte. Vielleicht ist es jetzt an den Stiftungen als Kapitalsammelstelle, davon etwas „zurückzugeben“ in Form von Investments in hiesige Aktien. Denn nur so können sie das Fortkommen des Standorts Deutschlands auch aktiv beeinflussen. Wo Aktien mehrheitlich von ausländischen Anlegern gehalten werden, sinkt dieser Einfluss, bis er ins Marginale driftet. An diesem Punkt steht das deutsche Aktionariat. Auch Stiftungen sollten das Unternehmen hinter der Aktie sehen. Denn dieses Unternehmen erfindet beispielsweise Impfstoffe, die Menschenleben retten. Und von solchen Unternehmen gibt es hierzulande jede Menge.
TV-TIPP:
Auch in Folge 2 von #fondsfibel AKTUELL, unserem TV-Talk rund um Stiftungsfonds & Co. dreht sich im Gespräch mit Petra Träg von der SOS Kinderdorf-Stiftung und Christian Fastenrath (impact Asset Management) alles um die Frage, wie Stiftungen in einer Zeitenwende ihr Stiftungsvermögen zeitgemäß aufstellen.
Frage 2: Haben Stiftungen eine Antwort auf das sicherheitspolitische Umwälzen und dessen Folgen?
Die Frage nach dem Standort Deutschland ist allerdings nicht ganz trivial, denn die Energieproblematik verändert das „Spiel“ grundlegend. Sie ist ein Game Changer. Umso gespannter waren wir auf die Ausführungen von Wolfgang Ischinger, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Der weitgereiste und tiefinformierte Sicherheitsfachmann eröffnete seinen Impuls mit wenig positiven Worten, um aber dann in der Diskussion das Konstruktive überwiegen zu lassen. Für Ischinger, der am Morgen der Konferenz aus Washington kam, darf der Epochenbruch nicht unterschätzt werden. Deutschland hatte es sich nach 1949 im Status quo der Zweiteilung bequem gemacht, als Ziel stand immer das überwinden der deutschen Teilung im Raum. Als dies geschafft war im Jahr 1990, hat sich eine – ich übersetze das jetzt mal – eine Bräsigkeit über die deutsche Sicherheitspolitik gelegt, die mit einer gewissen Blindheit einherging. Die deutsche Politik übersah, dass „der Partner (Russland) nicht mehr Partner sein wollte“, so formulierte es Ischinger.
Den Europäern diktierte Ischinger drei Pflichten in ihr Aufgabenheftchen. 1) Die EU muss sicherheitspolitischer Akteur werden. 2) Die Transatlantische Verbindung muss proaktiv weiter gestärkt werden und Europa muss alles dafür tun, dass in den USA nicht wieder ein Isolationist „drankommt“. 3) In China macht Europa nur einen Stich, wenn es als 450 Mio. Europäer auftritt. Europa braucht eine kohärente China-Strategie. Was bedeutet das für das Stiftungsvermögen? Es kann sein, dass manche Anlageräume wegfallen, weil sie „unser“ Wertegerüst nicht teilen. Es kann sein, dass im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie das Thema Rüstung und Sicherheit zumindest neu diskutiert werden muss. Last but not least kann es sein, dass Stiftungen dem Diversifikationsgebot künftig noch mehr Gewicht einräumen müssen. Denn die Welt wird durch die neuen sicherheitspolitischen Linien noch komplexer werden, worauf die Märkte hier und da mit einem Komplexitätsabschlag reagieren werden. Dieser wird umso weniger Schieflagen im Stiftungsvermögen auslösen, je breiter bzw. gezielter diese diversifiziert ist.
Frage 3: Kann Stiftungsvermögen Zukunft?
Eines darf die Diversifikation dabei nicht missen: die großen Zukunftsthemen. Auf dem Lupus alpha Investment Fokus 2023 wurde denn auch stimmigerweise die Frage diskutiert, ob Deutschland überhaupt Zukunft kann. Die relevante Frage dabei ist, ob Deutschland heute die Innovationsführerschaft in den künftig wichtigen Themen anstrebt, um in 5 oder 10 Jahren hier als Standort zu profitieren. Die Antwort muss leider Nein lauten an der Stelle, aber das kann auch eine Bestandsaufnahme sein. Deutschland müsste als Hochlohnland aber die Innovationsführerschaft in bestimmten Themen anstreben, weil die künftige Wettbewerbsfähigkeit exakt hieran hängt. Nur wer innoviert, ist kompetitiv.
Als Beispiel wurde die Deutsche Bahn angeführt. Es wäre an der Zeit, zu entscheiden, dass Züge künftig autonom fahren. Denn mehr Passagiere bedeutet mehr Züge, nur dass für diese neuen Züge gar nicht ausreichend Lokführer vorhanden sein werden. Den hier absehbaren Strukturbruch managen wir schlecht, in stabilen Konstellationen dagegen sei Deutschland stark. Heißt: Wir müssen daran arbeiten, besser im Strukturbruch zu werden. Genau hier kommt Stiftungen womöglich eine große Rolle zu. Sie bringen das Kapital, die Perspektive und die Zeit mit, in Strukturbrüchen Enabler für Neues zu sein. Stiftungen können ob ihrer Stellung einen Beitrag leisten, dass eben nicht mehr nur der kleinste gemeinsame Nenner das Ziel ist, sondern das Maximalmögliche. Stiftungen können Labore sein für das Out of the Box-Denken, das Deutschland braucht, um innovativer zu werden. Nicht zuletzt können Stiftungen ob direkt oder indirekt über Fonds Anteilseigner der Innovationsführer hierzulande werden – und damit Teil einer (hoffentlich) neuen Innovationskultur werden. Genau dann wird Stiftungsvermögen auch Zukunft können.

Zusammengefasst
Wir müssen unseren Hut ziehen vor dem Programm des Lupus alpha Investment Fokus 2023. Wer Wolfgang Ischinger vom Flugzeug auf die Bühne und dann eine fundierte Analyse zur welt-sicherheitspolitischen Lage bekommt, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Die Konferenz insgesamt sensibilisierte uns für das Thema Zukunft, das muss ich wirklich so sagen. Wo Deutschland 80 US-Dollar pro Kopf in Start-ups investiert, die USA deren 750 US-Dollar, ist viel Luft nach oben. Die Rolle von Stiftungen dabei? Einmal als diversifizierende und verantwortungsvolle Kapitalsammelstelle, zum anderen aber auch als Enabler. Stiftungen können Dinge voranbringen, die einen externen Katalysator oder einen völlig „frei drehenden“ Denkraum benötigen. Stiftungen werden Zukunft nicht nur können, sie werden Zukunft ermöglichen. Die Agenda Aufbruch in Ökonomie, Politik und Gesellschaft wird eine sein, die Stiftungen mitgestalten. Bei aller Unsicherheit: Das ist sicher.