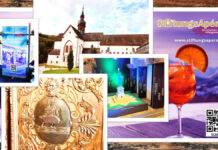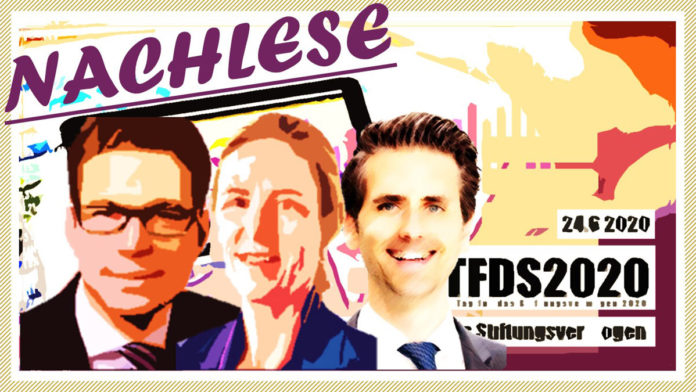Viele Anlagerichtlinien von Stiftungen sind etwas aus der Zeit gefallen, entsprechend kann die Anlagepolitik für das Stiftungsvermögen nicht mit der Zeit gehen. Diese Analyse teilten Berenike Wiener (Evangelische Bank), Immo Gatzweiler (AXA Investment Managers) und Dr. Stefan Fritz (Bischof Arbeo Stiftung) beim Virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen am 24.6.2020, gleichzeitig hatten sie aber auch Anregungen parat, wo und wie Stiftungsverantwortliche hier ansetzen könnten. Denn weder Anlagerichtlinie noch Anlagepolitik sind in Stein gemeißelt.
FÜR EIN SCHIFF OHNE HAFEN IST KEIN WIND EIN GÜNSTIGER
Die erste Frage der Diskussion setzte an der Frage an, ob Stiftungen überhaupt Anlagerichtlinien brauchen. Erwartungsgemäß fiel die Antwort einstimmig aus, jedoch auch nuanciert. Berenike Wiener: „Anlagerichtlinie? Definitiv ja, denn es wird immer schwieriger das Vermögen einer Stiftung zu verwalten. Die Situation an den Kapitalmärkten wird einfach immer schwieriger. Umso wichtiger ist es, dass sich die Verantwortlichen in Stiftungen ein Rahmenwerk geben, durch das sie mit Plan und Strategie vorgehen. Es gilt letztlich das Sprichwort ‚Für ein Schiff ohne Hafen ist kein Wind ein günstiger‘, an der Anlagerichlinie geht eben kein Weg mehr vorbei.“
Was für Stiftungen ein guter Plan bei der Erstellung der Anlagerichtlinie wäre, dazu meinte Berenike Wiener: „Zuerst würde ich in die Satzung schauen, es gilt, die Grundzüge der Satzung in die Anlagerichtlinie zu überführen und hierbei den Stiftungsauftrag zu berücksichtigen. Dann sollten Stiftungen schauen, welche Anlageziele sich setzen, auch in punkto Nachhaltigkeit, und welche Anlagegrenzen sie sich setzen, ohne dabei zu starr zu agieren. Der Rahmen muss passen, aber in diesem Rahmen müssen Anlageklassen atmen können. Auch gehört in die Anlagerichtlinie die Dokumentation, wie also zu welchem Zeitpunkt ein Reporting zum Stiftungsvermögen erstellt wird.“
ANLAGERICHTLINIEN AUS PRAKTISCHEN ERWÄGUNGEN HERAUS
Beim Thema Übersetzen der Satzung in die Anlagerichtlinie ergänzt Dr. Stefan Fritz: „Stiftungen brauchen Anlagerichtlinien nicht aus juristischem Sinne, aber sie brauchen Anlagerichtlinien aus praktischem Sinne heraus. Insbesondere, weil wir bei Stiftungen von Langfristanlegern sprechen, sind Anlagerichtlinien umso wichtiger, da sich Stiftungen bei Marktturbulenzen immer wieder auf diese zurückbesinnen können und eben nicht in Panik verfallen müssen. Die Anlagepolitik der ruhigen Hand, diese kann für Stiftungen eine gute Maßgabe sein.“ Denn sind in einer Akutsituation, wie Dr. Fritz es nannte, die Dinge vorab bereits geregelt, dann lässt sich dies aus der Schublade ziehen, so es doch einmal an den Märkten scheppert. Und je länger der Anlagehorizont, desto eher glätten sich kurzfristige Turbulenzen heraus. „Ein langfristiger Anlagehorizont ist das große Pfund, das eine Stiftung hat. Der größte Fehler, den eine Stiftung machen kann ist, kurzfristig zu reagieren. Sie sollten sich auch von der Kalenderjahresdenke freimachen, und das ist auch der ganz große Wert einer Anlagerichtlinie. Hier kann diese Langfristigkeit entsprechend hineinformuliert werden.“
Einen weiteren Impuls zur Anlagerichtlinie kam auch von Immo Gatzweiler von AXA Investment Managers. Auch für ihn hilft eine Anlagerichtlinie dabei, sich von der Kalenderdenke zu lösen, mit einer Besonderheit: „Ich bin bei Anlagerichtlinie weniger ein Verfechter von festen Investmentquoten etwa für Aktien oder Anleihen, sondern von Bändern. Da die Märkte atmen, sollten die Assetklassengewichtung in Stiftungsportfolios auch atmen. Ebenfalls würde ich die Assetklassen nicht zu eng fassen, denn dann ist man zu schnell im Kleinteiligen. Ebenfalls sollte in die Anlagerichtlinie eine breite Diversifikation eingebaut werden, wobei hierbei die einzelnen Anlageklassen breit definiert werden sollten. Ein zu enger Rahmen kann im aktuellen Umfeld ein Nachteil sein.“ Eine Ergänzung folgte hier von Berenike Wiener: „Ganz wichtig ist, dass die Anlagerichtlinie der Satzung nicht widersprechen darf. Und bei der Diversifikation gilt es, neben liquiden Anlagen auch illiquide Investments nicht vollkommen zu ignorieren.“
DOKUMENTATION ZEIGT, WIE PROFESSIONELL EINE STIFTUNG AGIERT
Das brachte die Diskussion zum Punkt der Dokumentation. Für Dr. Stefan Fritz sind oftmals viele Dinge die Finanzkommunikation betreffend in einer Stiftung nicht geregelt. „Wie soll die Anlageentscheidungen dokumentiert werden, welche Informationsquellen wurden hinterlegt, wer soll als Berater hinzugezogen werden, das sind Themen die neben der konkreten Aufteilung der Anlageklassen wichtig sind, um interne Abläufe zu regeln. Aber, und das wird häufig unterschätzt, solche Regelungen zeigen auch nach außen, dass die Vermögensanlage professionell organisiert ist. Ich bin davon überzeugt, dass die prozessualen Themen immer gewichtiger werden auch hinsichtlich der gesetzlichen Änderungen, die dann die Business Judgement Rule beinhalten werden.“
Interessant zu hören war auch der Hinweis bzw. die Vermutung, dass wenn sich jemand überlegt, eine Spende oder eine Zustiftung zu machen, es wichtig sein dürfte, genau diese Art von Professionalität zu zeigen, denn zeigt eine Stiftung diese nicht, dann geht die Spende eben an eine andere Organisation.
ANREGUNGEN FÜR DIE STIFTUNGSPRAXIS
Ein paar konkrete Anregungen für die Anlagepolitik hatten die Stiftungsexperten für Stiftungslenkerinnen und -lenker auch noch parat:
Immo Gatzweiler zum Thema Agieren im Crash: „An markanten Punkten einer Marktbewegung sollten nicht gezwungen sein, hektisch zu agieren, sondern sie sollten die Ruhe haben, auch von ihrem Anlagereglement her, dies aussitzen zu können. Wenn sich eine Stiftung zudem einem bestimmten Verlustmaximum verschreibt, sie also weiß, wie viel sie maximal als Delle aushält, dann kann sie sich aus der Historie heraus sehr schön den dafür passenden Aktienanteil herausselektieren.“
Berenike Wiener zum Thema Nachhaltigkeit im Stiftungsvermögen: „Viele Stiftungen stehen hier derzeit an dem Punkt, das Thema Nachhaltigkeit für sich zu definieren. Die Frage ist ja, wie überführe ich Nachhaltigkeit in die Anlagepolitik, aber was heißt ESG dann konkret. Wenn ich eine Umweltstiftung bin, dann denke ich anders über den Aspekt E von ESG als andere Stiftungen, und ich als Stiftung muss genau das dann so konkret wie möglich für mich zu definieren versuchen.“
Dr. Stefan Fritz zum Thema SDG: „Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen finde ich als Anlagevorgabe besonders anspruchsvoll. Denn daraus konkrete Anlageentscheidungen abzuleiten, ist nicht einfach. Der Einfluss aber ist da, denn sie stellen ein übergreifendes Wertesystem dar. Letztlich muss sich eine Systematik stetig weiterentwickeln, ursprünglich waren es die Ausschlusskriterien, mittlerweile sind es Themen wie Impact Investing oder Engagement, die aus der Eigentümerrolle auch von Stiftungen erwachsen, so sie Aktien eines Unternehmens halten.“
Berenike Wiener zum Thema Divesting: „Als Stiftung muss ich eine Haltung zu dem entwickle, was ich desinvestiere. Als Umweltstiftung habe ich rasche eine Haltung zur Kohle, als Bildungsstiftung dauert es vielleicht etwas, bis sich diese herauskristallisiert. Divesting ist der harte Ausschluss, Engagement bedeutet letztlich aus Stiftungssicht, dass man bewusst in Unternehmen investiert bleibt, um Veränderung mitbewirken zu können.“
Immo Gatzweiler zur Fondsanlage von Stiftungsvermögens: „Stiftungen sollen ihr Stiftungsvermögen breit streuen, und Fonds haben hier einen Vorteil. Fondsanlage spart Ressourcen, Nerven, und das Selbermachen beinhaltet das Risiko, dass das Abwägen von Investments einfach das fachliche Knowhow in Stiftungsorganen sprengt. Stiftungen müssen dem Diversifikationsgebot folgen, und mit Fonds können Stiftungen das sehr gut mit Inhalt füllen. Es müssen auch nicht immer nur Mischfonds sein, es können auch Anleihe- und Aktienfonds sein, die eben ausschüttend ausgelegt sind. Das Selbermachen ist aber heute umso schwieriger, je weniger visibel das Umfeld sich an den Märkten darstellt.
Berenike Wiener zum Selbermachen der Kapitalanlage: „Sind die Ressourcen da, ist die Kompetenz da, ist die Zeit da, dann kann das Stiftungsvermögen selber gemanagt werden. Mangelt es daran, sollte delegiert werden.“
Dr. Stefan Fritz zur Verwaltung des Stiftungsvermögens: „Für mich ist das Verwalten des Stiftungsvermögen immer auch eine Kommunikationsaufgabe. Wichtig ist, dass für alle Beteiligten ersichtlich ist, wonach die Anlage des Stiftungsvermögens gesteuert wird. Eine Stiftung muss sich über alle vorhandenen Gremien hinweg darüber im Klaren sein, wohin sie langfristig hinwollen, speziell in der Kapitalanlage. Vier Themen sollten für mich definiert sein. Was heißt für mich Kapitalerhalt, welche ausschüttungsfähige Rendite erwarte ich mir, welche Risiken bin ich bereit einzugehen bzw. welche Verluste tragen die Gremien mit und wie implementiere ich Nachhaltigkeit in die Anlagepolitik.“
ZUSAMMENGEFASST
Zu wissen wo ich stehe und wo ich hin will, das kann für Stiftungen so etwas wie der rote Faden sein, so etwas wie das Leuchtfeuer, das einem Schiff entlang der Küste den Weg weist. Für die drei Diskutanten stand zudem fest, dass Stiftungen eigentlich nicht mehr ohne Anlagerichtlinie in der Verwaltung ihres Stiftungsvermögens agieren sollten, und dass sie sich ihr Wesen als Langfristanleger zu Nutze machen sollten. In der langen Frist bleiben rückblickend oftmals nur Notizen, auch ein Corona-Crash dürfte in 30 Jahren dazu gehören.