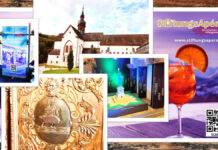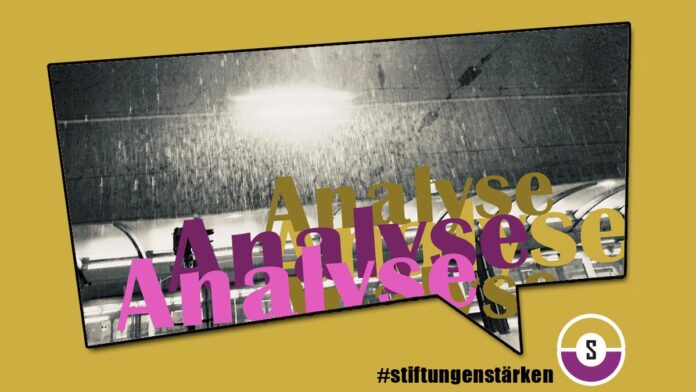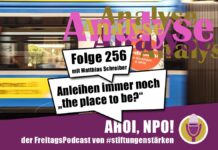Crash-Propheten haben derzeit Hochkonjunktur. KI-Hype und ETF-Blase sind aktuell die häufig genannten Stichworte. Die größte Gefahr droht langfristig aber bei den Staatsanleihen, genauer gesagt US-Treasuries. Der Allmählichkeitsschaden tröpfelt bereits vor sich hin.
Anleihen zählen weiterhin zu den großen Positionen im Portfolio zahlreicher Stiftungen. Das macht sie grundsätzlich besonders vulnerabel für Verwerfungen im Fixed-Income-Segment. Die Mehrzahl der global investierenden Anleihefonds setzt – natürlich – auch auf US-Staatsanleihen, da die Zinsen vergleichsweise attraktiv sind. Damit dürften zahlreiche deutsche Stiftungen in nicht unerheblichem Maße investiert sein, wenngleich einige Asset Manager schon heute auf US-Staatsanleihen verzichten. Dies geschieht meistens aber nicht aus Risikoabwägungen, sondern wegen Ausschlüssen etwa zum Beispiel wegen der Durchführung der Todesstrafe.
Gigantische Verschuldung
Prinzipiell gilt das Risiko für alle Formen von US-Staatsanleihen, von denen es grob gesagt drei Arten gibt, wobei die Kurzläufer natürlich weniger betroffen sind: Treasury Bills werden derzeit wöchentlich in den Laufzeiten 4, 8, 13 und 26 Wochen sowie monatlich in der Laufzeit 52 Wochen begeben. Treasury Notes sind mittelfristige Anleihen mit einer Laufzeit von 2 bis 10 Jahren, die regelmäßig Zinsen zahlen. Derzeit werden Notes mit 2, 3, 5, 7 und 10-jähriger Laufzeit emittiert, die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Treasury Bonds schließlich sind langfristige Anleihen mit Laufzeiten von 20 oder 30 Jahren. Gerade in der Null- und Minuszinsphase waren Langläufer aus den USA, Deutschland oder der Schweiz besonders einträglich, weil sie aus der Hochzinszeit stammend häufig Coupons oberhalb 6% abgeworfen haben. Schon deshalb besitzen Anleihen ganz grundsätzlich ihre Berechtigung gerade auch im Stiftungsportfolio, die 30-jährigen US-Bonds rentieren aktuell oberhalb von 5%. Ausführliche Informationen dazu auf der Bond-Seite des US-Finanzministeriums.
Worin liegen nun die besonderen Risiken von US-Treasuries? Es gibt eine Reihe von Gründen. Jeder für sich sorgt aktuell noch nicht für die Manifestation des Risikos, aber die Summe der einzelnen Entwicklungen ist besorgniserregend. Es droht ein Allmählichkeitsschaden.
KfW alarmiert öffentlich
An erster Stelle ist das wachsende Haushaltsdefizit der USA zu nennen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) formuliert es so: „Die USA stehen vor einer großen fiskalischen Herausforderung: Unter der geltenden Gesetzeslage steigt die Staatsverschuldung unaufhaltsam, die Zinsausgaben haben sich seit 2020 verdreifacht und das Sozialversicherungssystem gerät zunehmend unter Druck.“ Die dauerhafte Übernahme der 2017 beschlossenen Steuersenkungen im Rahmen des „One Big Beautiful Bill Act“ sorgen für zusätzliche Belastungen. Nach Angaben des US-Finanzministeriums belief sich die Staatsverschuldung der USA auf Bundesebene im Sommer auf 36,6 Billionen USD. Das sind 36.600 Milliarden USD. Die Schulden von Bundesstaaten und Gebietskörperschaften kommen noch „on top“.
„Damit droht die US-Staatsverschuldung mittelfristig außer Kontrolle zu geraten.“
Die Begründung für diese Politik besagt, dass durch niedrige Steuern das Wirtschaftswachstum angekurbelt werde und die dann sprudelnden Steuereinnahmen die Ausfälle überkompensieren. Historische Erfahrungen zeigen laut KfW aber, dass Steuererleichterungen langfristig nicht zu ausreichend hohem Wirtschaftswachstum führen, um die Einnahmeausfälle auszugleichen. Die Folgen fasst die KfW in einem nüchternen Satz zusammen, den man sich gleichviel auf der Zunge zergehen lassen muss: „Damit droht die US-Staatsverschuldung mittelfristig außer Kontrolle zu geraten.“ Denn die Simulationen der Bank zeigen, dass bereits geringfügige Erhöhungen der effektiven Zinssätze oder moderate Erhöhungen des Primärdefizits die Schuldenlast überproportional erhöhen.
Thema bereits während des Stiftungstages in Wiesbaden diskutiert
Bei den Chefvolkswirten wichtiger Banken wird das Thema bereits seit geraumer Zeit diskutiert, wie deren Diskussionsrunde während des Stiftungstages in Wiesbaden zeigt, über die wir hier berichtet haben. Die seinerzeit von Dr. Robin Winkler, Deutsche Bank, erwarteten Umschichtungen von Marktteilnehmern haben sich inzwischen manifestiert: Steigende Kapitalflüsse Richtung Asien und Europa sind mittlerweile dokumentiert.
Verdopplung der Schulden seit 2015
Innerhalb von gut zehn Jahren hat sich die US-Verschuldung verdoppelt: von 18,2 Billionen USD 2015 auf die genannten 36,6 Billionen USD im Sommer. Die Haushaltsbehörde des US-Kongresses geht davon aus, dass der „One Big Beautiful Bill“ die US-Schulden bis 2034 um weitere drei Billionen USD erhöhen könnte. Somit wächst die Zinslast weiter. In diesem Jahr wird die US-Regierung voraussichtlich 794 Milliarden USD an ihre Gläubiger berappen. In nicht allzu ferner Zukunft könnten die Zinszahlungen die Schwelle von einer Billion Dollar pro Jahr überschreiten. „Es bestehen wenig Zweifel, dass als Konsequenz des Gesetzes der Schuldenberg der USA weiter rasant wachsen wird“, befindet etwa KfW-Chefökonom Dirk Schumacher. Auch die mit Abstand einflussreichste US-Investmentbank Goldman Sachs hält die fiskalischen Aussichten der Vereinigten Staaten in einer von Volkswirt Alec Phillips veröffentlichten Mitteilung für eine „nicht haltbare Position“.
TACO als Problem
Das Akronym steht für „Trump always chickens out“. Gemeint ist damit, dass der US-Präsident zwar viele Zölle verhängt, wenn die Gegenmaßnahmen kommen aber allermeistens zurückzieht. Das verschärft die Finanzlage. Denn in der Argumentationskette dienen die Zölle als Argument, dank der immensen Einnahmen verringere sich das Defizit. Wenn aber Steuern gesenkt, Ausgaben ausgeweitet und keine Kompensation durch Zolleinnahmen – die in diesem Kontext nichts anderes sind als verkappte Steuererhöhungen über Inflation – entsteht, dann läuft die USA beschleunigt auf eine Schuldenkrise zu.
Erosion des Vertrauens in offizielle Statistiken
Der Angriff der aktuellen US-Administration auf Institutionen untergräbt die Glaubwürdigkeit in Statistiken aller Art. Dabei wird von republikanischer Seite ganz offen das Worts „purges“, also Säuberungen, verwendet. Die Entlassung der Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics, BLS), Erika McEntarfer, stellt dabei nur die Spitze des Eisbergs dar. Die Säuberungen fanden in einer Vielzahl von Behörden statt und trafen auch Mitarbeitende zum Beispiel bei der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), zu der auch der staatliche Wetterdienst NOA gehört. Wetter- und Klimadaten dieser Organisationen gelten seither als minder-vertrauenswürdig, was zum Beispiel auch direkte Auswirkungen auf den Kapitalmarkt besitzt, da zum Beispiel Auslöseschwellen bei CAT-Bonds häufig an offizielle Wetterdaten zu Hurricane-Stärken oder Niederschlagsmengen gekoppelt sind.
Angriffe auf die Unabhängigkeit der FED
Als besonders sensibel gelten die Angriffe des US-Präsidenten auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank FED. Notenbanker gelten weithin als noch vorsichtiger als Diplomaten, wenn es um Formulierungen geht. Um so bemerkenswerter, dass Bundesbankpräsident Joachim Nagel erneut vor politischer Einflussnahme auf die Arbeit von Notenbanken gewarnt hat. Die „politische Kritik“ an den Zentralbanken besorge ihn zutiefst, sagte er vor der US-Denkfabrik Foreign Policy Association in New York.
Die Unabhängigkeit der Notenbanken sei entscheidend für Stabilität, Vertrauen und sozialen Zusammenhalt. Negativbeispiele seien die große Inflation in den USA von 1965 bis 1982 und die hohe Teuerung in der Türkei 2022, die durch die Forderung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach niedrigen Zinsen verstärkt worden sei. Nagel verwies insbesondere auf die Unabhängigkeit und Verlässlichkeit von Statistiken und kritisierte, dass gewählte Amtsträger die Zuverlässigkeit wichtiger Wirtschaftsdaten offen infrage stellten, wenn diese nicht zur Sichtweise der Regierung passten. Mehr noch als die inhaltliche Positionierung muss allein die bloße Tatsache aufschrecken, dass der Präsident der Deutschen Bundesbank in den USA vor Ort offen und undiplomatisch für die Unabhängigkeit der FED eintreten muss.
Kampf gegen Windmühlen
In den USA wird pro Kopf mit Abstand am meisten Strom verbraucht. Die sichere Versorgung zählt zu den Grundpfeilern jedes Wirtschaftswachstums und damit steigender Steuereinnahmen. Der Kampf der Trump-Administration gegen eine zukunftsgewandte Energieversorgung findet wie im Kampf gegen ordentliche Statistiken auf allen Ebenen statt. Die Weisungen, genehmigte und fertiggestellte Offshore-Anlagen unter anderem von Orsted nicht ans Netz zu lassen, bilden ebenfalls nur die Spitze des Eisbergs. Vor allem um künftigen Strombedarf von KI-Rechenzentren zu befriedigen müsse mehr Erzeugungskapazität gebaut werden. Doch das US-Energieministerium hat im Oktober Fördermittel von mehr als 700 Mio. USD gestrichen und schreitet damit voran, Energieprojekte aus der Biden-Ära zu kippen. Auch Vorhaben in republikanisch geführten Staaten sind nun betroffen.
Farmageddon: US-Bauern zunehmend ratlos
In zahlreichen Bundesstaaten bildet die Landwirtschaft nach wie vor einen wichtigen Wirtschaftsfaktor mit entsprechend namhaftem Steueranteil. Doch aktuell droht vielen Landwirten der Ruin. Zunächst fehlen zehntausende Erntehelfer. Die zumeist unregistrierten Migranten werden durch die Einwanderungsbehörde ICE abgeschreckt. Hinzu kommt, dass die Zollstreitigkeiten dafür gesorgt haben, dass China bis auf weiteres kein Soja aus den USA mehr bezieht. US-Produzenten müssen ihre Ernte entweder zu Dumping-Preise anbieten oder zu erhöhten Kosten einlagern. Im ersten Halbjahr 2025 gingen 200 Höfe pleite, wobei die Bezeichnung „Höfe“ untertrieben ist, Farmen in den USA bewirtschaften gerne 5000 Hektar und mehr. Die Auswirkungen sind immens. Die Landwirtschaft trägt in den USA pro Jahr knapp zehn Milliarden Dollar zum Bruttoinlandsprodukt bei. In der Branche arbeiten eine Million Menschen. Auf den Sojabohnen-Sektor entfallen rund 230.000 Arbeitsplätze. Jetzt wird ein Rettungspaket geplant – bezahlt aus Strafzöllen…
Was bedeutet das für Stiftungen?
Stiftungen müssen drei Dinge unternehmen:
- In den Gremien muss geklärt werden, welchen Anteil US-Staatsanleihen im Portfolio einnehmen sollen – die klassische Risk-/Reward-Abwägung.
- Zu klären ist, welchen Anteil US-Staatsanleihen aktuell im Portfolio ausmachen, und vor allem welche Laufzeiten. Dazu kann man die Vermögensverwalter befragen, das ist schnell zu klären.
- Wenn der Anteil an US-Staatsanleihen im Portfolio nicht der Zielvorgabe entspricht sind Strategien zu besprechen und umzusetzen, wie die Zielquote erreicht werden kann.
Wie akut ist die Lage – und was ist zu tun?
Dazu nochmals die KfW: „Wie groß die Schuldentragfähigkeit letztlich ist und wann die Stimmung kippt, lässt sich nicht an Zahlen festmachen. Historisch betrachtet tritt der Tipping Point häufig dann ein, wenn Investoren beginnen Risiken neu zu bewerten oder sich ein grundsätzlicher Zweifel an der Stabilität des institutionellen Rahmens breit macht. Wie sich die amerikanische Fiskalpolitik weiterentwickelt, ist auch aus europäischer Sicht entscheidend. Steigende Zweifel an der fiskalischen Solidität der USA würden zu Verspannungen im globalen Finanzsystem führen, die auch in Europa zu spüren wären.“
Was können Stiftungen tun? Wir meinen, dass es weiterhin gute Gründe für einen individuell zu bestimmenden, nicht zu hohen Anteil Anleihen im Stiftungsportfolio gibt. Wenn es auch weiterhin US-Titel sein sollen, dann zum Beispiel den Allspring Global Income Fund, der mit seiner Flexibilität und dem kurzen Prognosezeitraum genau richtig für das aufgeführte Allmählichkeits-Szenario aufgestellt ist. Auch der BayernInvest Renten Europa als sehr dynamisch gemanagter Fonds passt genau in die unsicheren Zeiten. Der RLAM Short Duration High Yield Fonds aus dem Club der 25 stellt eine lohnenswerte Alternative dar, den genannten Risiken zu entgehen und dennoch hohe Renditen zu vereinnahmen.

Zusammengefasst
Bildlich ausgedrückt könnte man sagen: Wie bei einem Allmählichkeitsschaden, bei dem es monate- oder jahrelang hinter der Spüle tropft und man erst spät die schimmelige Wand entdeckt, läuft die Fiskalkatastrophe der USA langsam, allmählich, im Hintergrund ab. Der Schaden wird auch nicht gleich sichtbar, weil Statistiken nicht mehr korrekt sind und die Notenbank nicht mehr wirklich unabhängig ist. Am Ende der Entwicklung drohen Schuldenschnitte, ausgefallene Coupons und herbe Kursverluste. Wie die KfW zu bedenken gibt würde dieses Szenario auch den europäischen Markt beeinflussen – Stiftungen würden bei reduzierten US-Engagement aber immerhin nicht in der ersten Reihe sitzen.