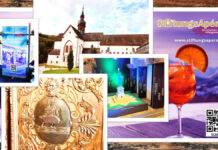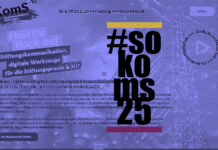Stiftungen kommt beim Bewahren unseres Wohlstands vermutlich eine besondere Rolle zu. Diesen Satz nehme ich vom diesjährigen Österreichischen Stiftungsfrühling mit nach Hause, insbesondere weil die Diskussion um die Rolle von Stiftungen in Deutschland anders geführt wird – derzeit und künftig auch. Meine drei take aways beziehen sich auf die Stiftungspraxis und auf die Stiftungsstandorte, denn hier hat Eines Einzug gehalten: der Wettbewerb.
Immer im Mai steht eine Reise nach Österreich an. Denn der Gründer der Stiftung NextGen und Macher hinter dem Österreichischen Stiftungsfrühling, Manfred Wieland, lädt nahe Salzburg zum fachlichen wie persönlichen Austausch ein. Als Deutscher bin ich immer ein wenig der Exot unter den Gästen, was mich immer wieder fasziniert ist das Anderssein des österreichischen Stiftungssektors mit seinen gut 3.000 Privatstiftungen und gut 700 gemeinnützigen Stiftungen. Die tägliche Stiftungspraxis ist dazu geprägt von einem seit 2010 nicht mehr reformierten Stiftungsrecht (was wohlgemerkt jeder Akteur in Österreich anprangert), ein Referent brachte es mit „Wir haben es mit einem versteinerten Stiftungsrecht zu tun, und weniger mit einer versteinerten Stiftungslandschaft“ auf den Punkt. Manfred Wieland stellt das Vortragsprogramm so zusammen, dass zwar die Praxis der österreichischen Stiftungen im Fokus stand, dass aber Ableitungen auch für deutsche Stiftungen zu treffen sind.

Lehre Nummer 1: Österreich fällt im Wettbewerb der Stiftungsstandorte zurück
Es wurde relativ deutlich benannt, wie es um den Stiftungsstandort Österreich steht: nicht zum Besten. Insbesondere die Stiftungsrechtsreform in Liechtenstein und Deutschland geben Anlass dafür, zu fragen, warum sich Österreich im Stiftungsrecht nicht auch auf den Weg macht, endlich für Zukunftssicherheit des Modells Stiftungen zu sorgen. Denn Stiftungen bilden in unserem Nachbarland einen gewichtigen Nukleus des Kapitalstocks, wenn die Politik nicht dafür sorgt, dass sich Stiftungen erneuern können, besteht die Gefahr, dass der österreichische Kapitalstock (und damit das Rückgrat des österreichischen Mittelstands) zerfasert.
Ich nehme für mich mit, dass es wichtig ist, an den Standortfaktoren permanent zu arbeiten, das Stiftungsrecht fortwährend zu revitalisieren, und zwar nicht so, dass sich Stiftungsrechtler daran austoben, sondern eine moderne Stiftungspraxis darin Ausdruck findet. Beim Abendessen berichtete mit ein auf Stiftungsrecht spezialisierter Rechtsanwalt, dass die Krise hausgemacht sei, und dass das psychologische Momentum die künftige Prosperität des österreichischen Stiftungssektors betreffend in Negative gedreht hätte. Durch das politische Nicht-Agieren, woraus wir in Deutschland einen Schluss ziehen müssen. Stiftungen brauchen eine moderne Infrastruktur (=rechtlicher Rahmen), auf der sie reüssieren können, und keine altmodische oder überholte.
Lehre Nummer 2: Konflikte in Stiftungsgremien lässt sich organisatorisch begegnen
Ein weiteres Feld, über das spannend referiert wurde, war jenes der Konfliktvermeidung. Im familiären Kontext zwar, was der Besonderheit der Privatstiftung mit ihren eigenen Realitäten geschuldet war, aber für eine deutsche Stiftung ließ sich hier für den generationellen Übergang in den Stiftungsgremien Einiges mitnehmen. Einmal lassen sich Konflikte organisatorisch auffangen oder abfedern. Wenn zum Beispiel ein Generationswechsel in einer Stiftung ansteht, dann ist es immer gut, die nachfolgende Generation in die Diskussion der künftig wichtigen Fragen mit einzubeziehen.
Dazu empfiehlt es sich für die abtretende Generation, nicht künstlich Konflikte mit den nachfolgenden Verantwortlichen zu stilisieren. Die Rolle des Beirats für fachliche Themen, etwa das Stiftungsvermögen, dürfte eine tragendere werden, um genau Konflikte nicht ausufern zu lassen, dessen Arbeitsgrundlage könnte ein „letter of wishes“ sein, denn die noch verantwortlichen Gremien dem Beirat mit ins Pflichtenmapperl legen. Auch eine D&O-Versicherung kann eine wichtigere Rolle spielen, um eine Stiftung organisationell neu aufzustellen.
Nicht zuletzt wurde die Möglichkeit vorgestellt, eine Mediation einzuschalten, um Konflikte auszuräumen, nachdem sie benannt und sortiert wurden. Diese verschiedenen Spielarten, Konflikte in Stiftungen zwischen der Generation 1.0 und der Generation 2.0 anzugehen, fand ich sehr spannend. Und es war auch wahrzunehmen, dass das Thema bei den Teilnehmern des #ÖSF25 zu weiterführenden Diskussionen anregte.
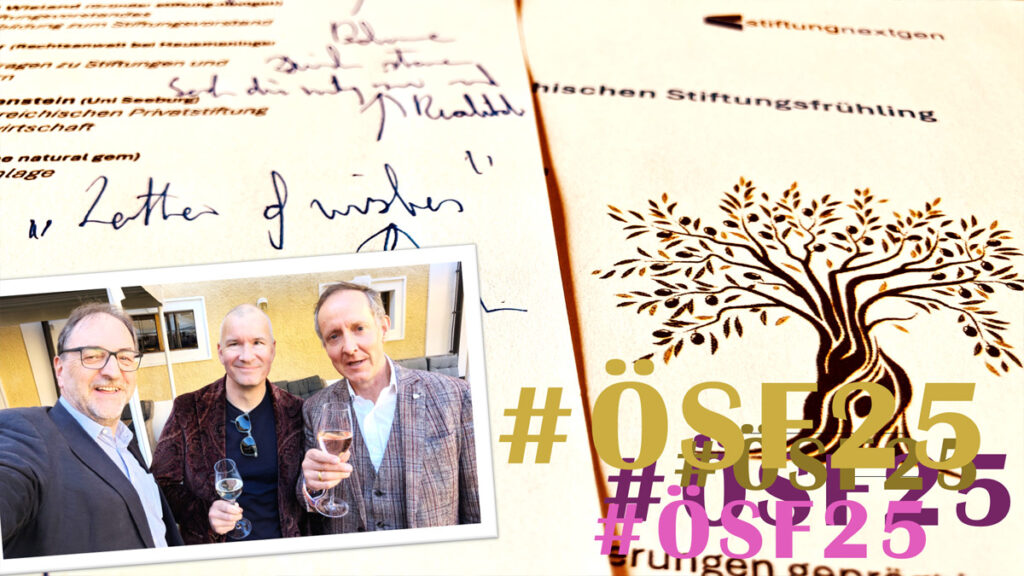
Lehre Nummer 3: Stiftungen werden von Menschen gemacht
Am Nachmittag stand eine Art Pitch auf der Agenda, drei Stifter erzählten, wie sie zu ihrer Stiftung kamen und welche Herausforderungen sie aktuell zu schultern haben. Ich mag ja solche Formate, denn so nah kommt man Stiftungspersönlichkeiten selten. Umso mehr freute es mich, dass Manfred Wieland und sein Team solch eine Stunde ins Programm gepackt hatten.
Die drei Stiftungen hatten immer einen unternehmerischen Hintergrund, einen weltweiten Logistikdienstleister zum Beispiel, oder ein Blech verarbeitendes und damit hochspezialisiertes Unternehmen.
Was mich beeindruckte: Mit welcher Selbstverständlichkeit hier das Generationen-übergreifende gelebt wurde, und wie klar die aktuellen Herausforderungen und die Herangehensweise benannt wurden: Mei, das müssen wir halt machen, vom Abwarten lösen sich Probleme nie. Diese Haltung nötigt mir ein Maximum an Respekt ab, ich konnte auch mit dem Fundraiser der Bruderschaft St. Christoph, Florian Wagner, sprechen, er setzte noch einen obendrauf: Wenn Du nicht fragst, bekommst Du nicht wenig, sondern gar nichts. Dieses Machertum begegnete mir auf dem Österreichischen Stiftungsfrühling einmal mehr, und es lässt ich glauben, dass das Beste am Stiftungsstandort Österreich noch kommt.
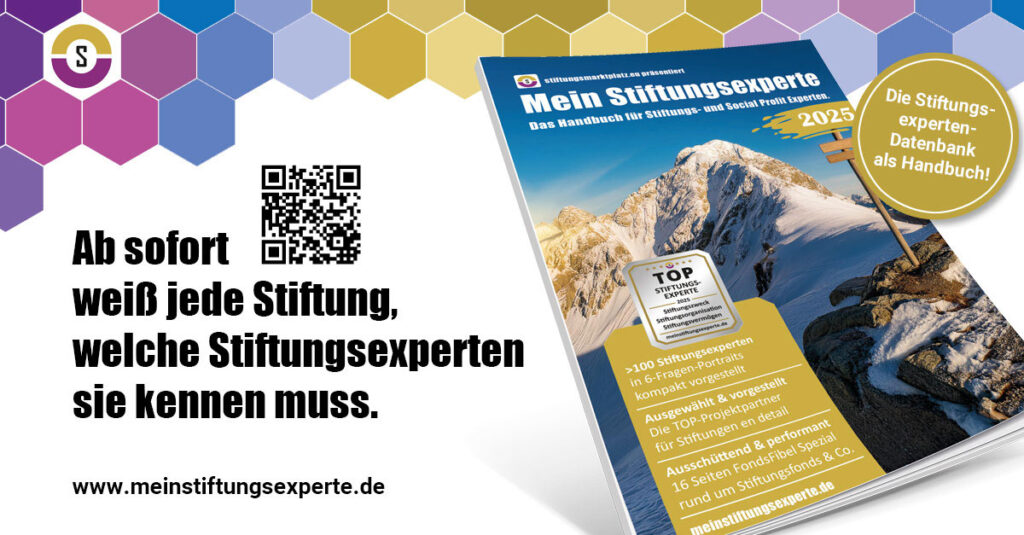
Zusammengefasst
Mein Dank gilt Manfred Wieland und seinem Team, die mit dem wieder Zuschauer-stärkeren Österreichischen Stiftungsfrühling im Schloss Mondsee wieder einen Ort geschaffen haben, an dem sich Praktiker aus der Stiftungslandschaft Österreichs treffen, um heute miteinander über die Stiftungslandschaft von morgen zu sprechen – und die Themen, die Stiftungs-intern angegangen werden müssen. Das Motto „Wohlstand bewahren“ hatte Manfred Wieland treffend gewählt, denn Stiftungen werden hierbei eine gewichtige Rolle spielen, so sie bzw. der Rahmensetzer einige Hausaufgaben erledigen. Denn dass es diese gibt, das zeigten die Gespräche im Schloss Mondsee deutlich. Dass es aber auch genug Menschen gibt, die an das Meistern dieser Herausforderungen glauben, das schälte sich beim #ÖSF25 einmal mehr heraus. Daher bleibt mit nurmehr, ein dickes Dankeschön an das #ÖSF25-Team zu richten – wir sehen uns wieder beim #ÖSF26 (oder schon vorher am 9.9.2025 ab 17 Uhr beim StiftungsApéro in Salzburg).