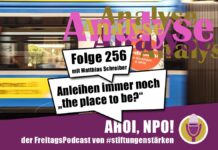Stiftungsvermögen hat einen Auftrag. Es hat der Stiftung zu dienen, und zwar, um den Stiftungszweck zu verwirklichen. Dafür muss es angelegt sein. Ein einfacher Dreisatz eigentlich, und dennoch kommen in Zeiten wie derzeit, in denen an den Börsen nur die Unsicherheit sicher ist, immer die gleichen Fragen auf die Schreibtische von Stiftungsverantwortlichen. Dabei müsste das nicht sein, denn Stiftungsvermögen und dessen Management muss nicht Märkte können, sondern Resilienz.
Im Jahr 1985 kam nicht nur der Film Zurück in die Zukunft in die Kinos, sondern auch der zweite Teil der Reihe um die Hauptfigur John Rambo. Es ist ein mittelmäßiger Film, zugegeben, aber der Untertitel passt zum Stiftungstun: der Auftrag. Denn der Auftrag des Stiftungsvermögens ist es ja genau, fortwährend eine ausreichend große finanzielle Basis zur Verwirklichung der Stiftungszwecke zur Verfügung zu stellen. Einen immer ausreichend großen Pool an Möglichkeiten, diese Zwecke mit Leben zu füllen, so könnte man es auch sagen. Dieser Auftrag ist sakrosankt, dieser Auftrag besteht, solange eine Stiftung besteht, und dieser Auftrag muss erfüllt werden, auch wenn die Börsen etwa durch präsidentielles Zollirrlichtern oder geostrategische Verschränkungen heftigst im Schwitzkasten gehalten werden. Derlei darf Stiftungsvermögen nur periphär tangieren. Womit wir bei David Swensen wären, dem legendären Manager des Yale-Stiftungsvermögens, der übrigens auch 1985 seinen Dienst aufnahm.
Stiftungsvermögen und die richtige Haltung der Verantwortlichen
Wobei Dienst das falsche Wort ist, denn Swensens Haltung zu und Idee für Stiftungsvermögen, wie es gemanagt werden soll, das was etwas grundlegend Neues. David Swensen sah seinen Auftrag darin, Stiftungsvermögen auf das zurückzuführen, was es ist, nämlich ein Pool und ein Hort von Möglichkeiten. Vorausgesetzt das Stiftungsvermögen wird zeitlos und zeitgemäß investiert.
Für Swensen hieß das, breit gestreut, losgelöst vom Marktgeschehen, es hieß zu delegieren, aber davor eben auch die besten und passendsten Asset Manager zu selektieren. Swensen legte lieber für 15 Jahre denn für 15 Monate an, er sprach immer vom Privileg der Langfristigkeit, das Stiftungen qua Stiftungs-DNA (auf ewig errichtet, und so) ihr Eigen nennen. Man wüsste gerne, wie er das Geschehen an den Börsen heute beurteilte. Jedoch würde David Swensen vermutlich über das Trump’sche Ballyhoo nur den Kopf wiegen und sagen, dass das Management von Stiftungsvermögen sich nicht an Börsenständen orientieren sollte, sondern an der Frage, ob das wirtschaftliche Stehvermögen weiterhin gegeben ist.
Was würde Swensen über Trump sagen?
Es wäre diese unaufgeregte Stimme der Vernunft, der wir gerne zuhören, und deren Worte wir für die deutsche Stiftungslandschaft zu übersetzen suchten. Denn dass in vielen deutschen Stiftungen bereits wieder die Alarmglocken schrillen, das ist vernehmbar, und erzählen Stiftungsmanager, dass sie etwas den Fuß vom Gas genommen, sprich: die Aktienquoten etwas reduziert haben. Nichts sei derzeit sicher außer der Unsicherheit, und gar nichts wäre schlimmer für eine sachgerechte Entscheidung als dieser Wulst an Unsicherheit. Denn muss Stiftungsvermögen auch in diesen Phasen investiert werden, dennoch muss auch in diesen Phasen die Basis für die Ausgabeseite geschaffen werden. Wer die Basis nicht schafft, wenn die Börsen fallen, der hat die Basis dann auch nicht, wenn die Börsen steigen. So jedenfalls könnte man denken, wäre man nur in börsennotierten Aktien und Anleihen oder hier investierenden Fonds investiert.
Jede Stiftung braucht ein Anlagekonzept
Was Stiftungen jetzt in unseren Augen machen müssen, ist sich drei Fragen zu stellen. Stiftungsverantwortliche haben jetzt entsprechend einen Auftrag, damit Stiftungsvermögen seine Aufgabe weiter wird erfüllen können. Die erste Frage betrifft das Anlagekonzept. Gibt es auf dem Depotauszug wieder hässliche rot Minuszeichen, entsteht also womöglich wieder eine Minusposition, die ggf. über die Umschichtungsrücklage aufgefangen werden muss? Dann kann es sein, dass am Anlagekonzept Hand angelegt werden muss. Denn ein Konzept immer nur auf zwei Beinen zu fußen, auf Aktien und Anleihen, ist womöglich kein Konzept. Zumindest keines, mit dem eine Stiftung dauerhaft arbeiten sollte. Wankt der Aktienmarkt, wird das Hemd feucht, steigen dann auch noch die Zinsen und fallen die Rentenkurse, wird das Hemd nass. Das Anlagekonzept, übersetzt in die Anlagerichtlinie, ist das A und O beim Investieren des Stiftungskapitals. Ohne Konzept keine Resilienz, und ohne Resilienz keine ewige Fortführungsprognose.
TV-Tipp:
Das große Ding Stiftungsvermögen in kleinen Schritten lernen? In der #vtfds-Mediathek finden Stiftungen alles genau dafür.
Wer kümmert sich bei uns künftig ums Stiftungsvermögen?
Die zweite Frage, anknüpfend an das Konzept ist die nach dem Wer. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, Stiftungsvermögen, das mach ich doch seit Jahren mit links. Denen sei gesagt, dass 2 oder 3% ordentlicher Ertrag schön sind und rechtlich auch nicht verwerflich, aber die Möglichkeiten des Stiftungsvermögens wurden damit bei weitem nicht ausgeschöpft.
Es muss der Auftrag einer jeden Stiftung sein, das Maximale aus dem Stiftungsvermögen rauszuholen, in Prozent, und damit an Liquidität für die Ausgabenseite und Rücklagensphäre. Viele werden entgegnen, dass das in den vergangenen 15 Jahren nicht ging. Wirklich, die 10er Jahre, die meisten der 20er Jahre haben es nicht hergegeben, 5% ordentlicher Ertrag zu erwirtschaften? Oder 6%? Es war schwer, diese Renditegrößen in den vergangene 15 Jahren nicht zu erreichen, und es grenzt nicht an Ignoranz sondern deutet auf eine strukturelle Pflichtverletzung der Stiftungsorgane hin, dass dies so als Leitsatz akzeptiert wird. Womöglich sind jene, die bisher Stiftungsvermögen gemacht haben, nicht die richtigen. Es braucht hier den kritischen Diskurs.
Reicht die bisherige Diversifikation für mein Stiftungsvermögen aus?
Frage Nummer 3 in Zeiten crashiger Börsen muss lauten, ob die gewählte Diversifikation ausreicht für das Umfeld, in dem sich das Stiftungsvermögen bewegt. Die Zeit von 4% sicher und noch n bisschen was über die Aktienquote obendrauf, die sind vorbei.
Warum wir auf Swensen insistieren? Weil es Recht hatte mit seiner Idee vom Management von Stiftungsvermögen, und weil er letztlich nur etwas aktiviert hat, was es hierzulande schon bei den vielen jahrhundertealten Stiftungen zu beobachten gab. Stiftungen sind Sachwerteinvestoren par excellence, Stiftungen haben den langen Atem, und Stiftungen brauchen ihre Entscheidungen nicht mal mit Mut oder Handwerk begründen, sondern können dies mit Historie unterlegen. Pfründestiftungen, Hospizstiftungen, Unternehmensstiftungen, allen ist die DNA des Sachwertinvestors in die Wiege gelegt worden, allen gemein ist der breite Mix der Anlagen, der es letztlich gerichtet hat. Wir müssen hier auch die Umstände bedenken, gerichtet hieß früher, dass da nach einem Krieg noch was war, auf was sich wieder aufbauen ließ.
Diese harte Resilienz müssen wir wieder lernen, auch wenn es sich in uns sträubt, und dafür ist die Diversifikation der wichtigste Eckpfeiler. Der Auftrag lautet, Stiftungsvermögen wirtschaftlich stehfest zu machen und zu halten, und die Frage danach, die gehört auf die Tische der Stiftungsgremien aller deutschen Stiftungen.
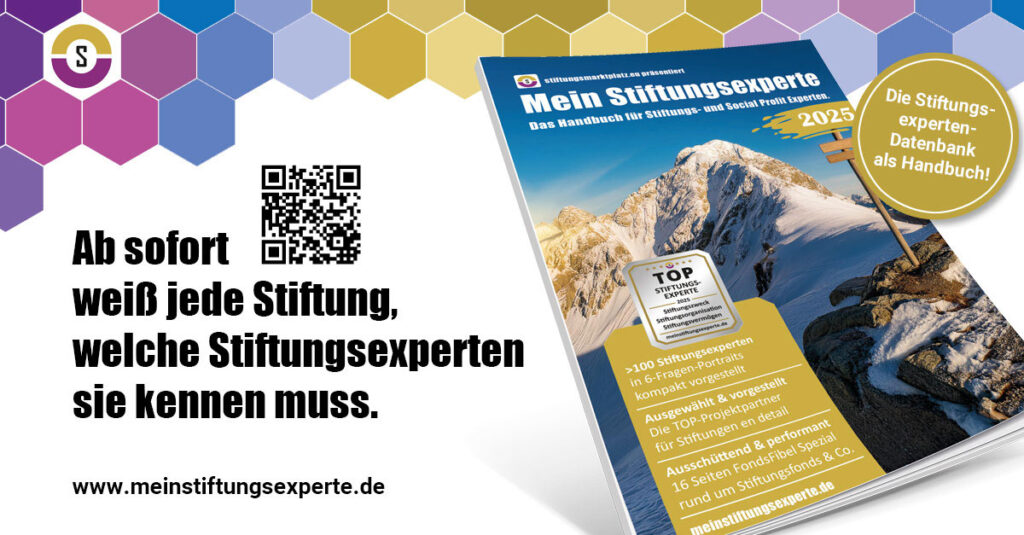
Zusammengefasst
Die Börsen sind weltweit in Turbulenzen, und so manches Stiftungsvermögen kommt wieder ins Taumeln. Im Crash jedoch zu reagieren, war noch nie ein guter Rat, Stiftungsverantwortliche hätten vorher agieren sollen – oder sollten dies nun tun, wenn sich der Staub etwas gelegt hat. Denn das wird er, selbst wenn es zunächst noch schlimmer werden sollte. Stiftungsvermögen muss bei alldem investiert werden, dafür muss es diversifiziert werden, der Auftrag lautet: Mach, dass ist meine Zwecke immer verwirklichen und ich meine getätigten Zusagen einhalten kann. Ob es dafür einen Rambo braucht, der im Stiftungsvermögen mal aufräumt, das kann und muss jede Stiftung nur für sich beantworten. Dass es für viele deutsche Stiftungsvermögen aber ein Zurück in die Zukunft braucht, davon ist auszugehen.